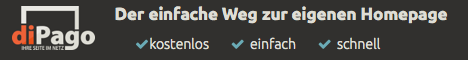Herzlich Willkommen auf dieser Seite!
Technische Ausrüstung, warum Midi, mobile "all in" PA, Technische Problemchen
Obwohl ein Akkordeon mit Bassknöpfen und Tastatur ausgestattet ist und ohne Strom sozusagen autark funktioniert bedarf es zudem für besondere Anlässe hin- und wieder einer zusätzlichen Beschallung (Bühnentechnik) oder andersartige Ergänzungen meiner Darbietungen. Auch ist es ja so, dass man(n) auch mal zum üben ganz leise z. b. über Kopfhörer spielen muß. Das geht halt nur mit stromabhängiger geeigneter Technik.
Meine derzeitige technische Ausrüstung für Darbietungen z.B. flott, spontan bei Oma oder Geburtstagsfeiern (passt alles in einen Koffer) bei kleinen Anlässen und bei guter Raumakustik ist eine Mini-Bluetooth Musikbox mit 30 W (aus dieser läuft im Halbplayback die Begleitmusik wie der Bass,Tuba, Schlagzeug und anderer ergänzende Begleitinstrumente die mit Hilfe durch *Midi Files- übers Handy oder IPad gesteuert wird) und dazu ein live gespieltes Akkordeon und je nach dem auch mit Gesang. In größeren Räumlichkeiten nutze ich eine weitere mobile stärkere und etwas größere aktive Bluetooth Box mit 150 W und dazu Mikrofone mit Funktechnik. Wie sich sowas anhört könnt ihr in den bereitgestellten weiteren THEMENSEITEN entnehmen..
Zur Technik
Ich besitze derzeit neben einem Keyboard Tyros 5 auch zwei Tasten- Akkordeons, eine Hohner mit 96 Bass und 9 kg Gewicht und ein Weltmeister mit 48 Bass mit 5,3 kg Gewicht. Zum üben nehme ich, wenn ich dabei sitzen kann, das "schwere" und bei Auftritten, wobei ich denn stehe, wegen Rückenschmerzproblemen, das "leichtere". Beide Akkordeon sind daher ohne zusätzlich verbaute Funk- und Miditechnik.
Diese nachrüstbare Technik" ersetzte ich, auch um Gewicht zu sparen, derzeit, abgespeckt als Kompromiss, mit einem zusätzlichem IPad oder Handy auf deren ein digitaler Midifileplayer installiert ist mit darin abgespeicherten eingespielten Midifiles. Damit kann denn über Bluetooth der entsprechende aktive Lautsprecher angesteuert werden.
Warum digitale Midi Files, warum Halbplayback?
Zum einem um das Gewicht durch zusätzlicher Einbauten in den Akkordeons gering zu halten und zum anderen ergänze bzw. pimpe ich dadurch meinen Auftritt akustisch mit weiteren der Musikrichtung entsprechenden Musikinstrumenten.
Z.B. was wäre alpenländliche Stimmungsmusik ohne das tradidtionsentsprechende Begleitinstrument des Blasinstrumentes der Tuba oder einer begleitenden Gitarre. Midi Files ersetzen mir sozusagen digital und kostengünstig eine Begleitbänd, Notenhefte und zudem indirekt ein Metronom (Taktgeber). Da macht auch das Proben mehr Spass.
Die Nachteile gegenüber einem Akkordeon mit Miditechnik sind halt das man z.B. das Klangbild des live gespielten Akkordeons ohne derartiger eingebauter Technik digital nicht zusätzlich verändern kann und daher auch nicht per Knopfdruck in andere Klänge oder Halbton-Tonlagen transponieren kann. Mit Kopfhörer geht denn selbstredend auch nicht.
Wenn mit meiner improvisierten Technik mittels Halbplayback ein aufgerufenes Midifile Tonlagensprünge vorprogrammiert hat muß man das denn auch selber spielen können bzw. muß die unterschiedlichen Dur- oder Mollarten in unterschiedlichen Tonleiter und passender Harmonie beherrschen. Und falls man mitsingt auch diese Tonlagen singen können.
*Viel schöner und einfacher mit noch mehr Spaß an der Sache wäre es natürlich mit einem MIDI Akkordeon und echten Musikerfreunden, aber man muss sich in der Not zu helfen wissen.
Ein kleiner Nachteil von Akkordeons mit verbauter Miditechnik, gegenüber deren zahlreichen Vorteilen, sind zum einem Stromabhängigkeit (Strom-Kabel hinzu des Akkordeon und ein zweites vom Akkordeon hinzu des Verstärkers erforderlich oder eingebauter Akku und Funktechnik) und das verbaute zusätzliche Gewicht. Oft kommt dazu noch die Technik eines Schwanenhalsmikrofons mit einem Akku gespeisten Sender. Bei Reparaturen beeinträchtigt und erschwert die verbaute Technik und Verkabelung zudem die Zugänglichkeit oder im Falle digitaler Probleme die Fehlersuche.
Zurück zum Midifile
Digitale Midi Files in einem Player abgespielt bieten den Vorteil, dass zum einem einzelne Instrumente die im File bzw. im Lied vorkommen und die man lieber live selber spielen möchte im Player stumm geschaltet werden können und Lautstärken von weiteren einzelnen mitlaufenden Instrumenten regulierbar und in ihrer Klang- und Tonart auswechselbar sind. Man kann z.B. einen vorprogrammierten Klang einer Gitarre auf den Klang einer Trompete oder einem Klavier umstellen. Man kann Tonlagen eines Liedes höher oder tiefer schalten .
Ansicht im Midifileplayer (es können wie unten zu sehen mehrere Ansichten aufgerufen werden)
.
Desweiteren werden im Display des Players, der auf einem Handy oder IPad installiert ist, Liedertexte und Akkorde in gewünschter Schriftgröße hinterleuchtet und in Abfolge des Liedes angezeigt und machen das Lesen selbst in "Schummer" Beleuchtung möglich. Die voreingestellten Begleitungen und Liedertexte tragen/führen/leiten einen sozusagen durch die Melodie bzw. bringen den "Hook" auch ohne Noten in Errinnerung. Man kann die "Begleitung" vorab, genau wie bei einem Midiakkordeon auch, in die gewünschte Tonart transponieren und so abspeichern wie man es gerne hätte und spielen kann. (Allerdings um im Midifile bereits einprogramierte Tonlagensprünge zu begegnen muß man entweder diese spielen können oder dieses Midifile mit einer zusätzlichen Edditorsoftware bearbeiten und die Tonlagensprünge löschen oder in Tonlagen die man beherrscht höher oder tiefer setzen).
Man kann im Midifile-Player sein Reportoire in Form von verschiedenen Playlisten Medleys (Stimmungs- Lieder Konzepte) erstellen die in einer "Playlist" nacheinander in gewünschter Anzahl und Reihenfolge im Pack abspielen, um während des Vortrages die Hände fürs Akkordeon freizuhalten. Diese Listen können für den ständigen Gebrauch abgespeichert werden. Man kann es so einstellen, das die Lieder in der Playlist automatisch nacheinander abspielen oder wahlweise auch die Lieder-Begleitung einzeln per Knopfdruck abrufen.
Fertige Midifiles sind einzelnd für derzeit ca. 12 € -15 € zu haben. Man kann sich somit relativ günstig beliebig und aktuell in seinem Reportoire halten, wobei mit günstig der erparte Zeitaufwand gemeint ist um ein Midifile selber zu erstellen. Wenn man mal hochrechnet dass in 60 min ohne Spielpausen bis 20 Lieder gespielt werden könnten, hier bereits ein Betrag im Schnitt bis 300 € in Vorkasse zu Lasten des Alleinunterhalters investiert werden mussten, die es im Verrechnungssatz (Siehe hierzu die Themenseite was kostet ein Alleinunterhalter) mit umzulegen gilt.
Zusätzliche Beleuchtung für Notenhefte, Noten lesen ansich und ständiges hin- und her blättern und sortieren werden dadurch weitgehend überflüssig, so dass man ohne Stimmungs-Unterbrechung durch zu langen Pausen, Gas geben kann.
Ein kleiner Nachteil ist, dass Sounds nicht in höchster Qualität bzw. z.B. nicht in Stereo wiedergegeben werden können, sondern nur in Mono. Auch sind die Soundbänke des GM (General Midi) Format der einzelnen Instrumente oder Chöre im Player nur in vorgegebener Auswahl standardmäßig begrenzt verfügbar. Aber das gerät bei Kurzauftritten mit einem live gespielten Instrument und Livegesang durch deren Präsens stets in den Hintergrund, da der Augenmerk und die Wahrnehmung der Akustik zunächst nur auf die Vorführung selbst gerichtet ist.
Ein weiterer Nachteil ist halt, dass man sich keine großen Spielfehler erlauben kann, da ein Midifile gnadenlos ohne Stopp in vorprogrammierter Reihenfolge alles richtig weiter abspielt. Wenn man trotzdem mal rauskommt (das passiert meist bei vorprogrammierten Tonlagenwechsel in Halbtonschritten) und den Faden verliert hilft nur noch mitsingen und anstelle der Melodie dann umzuschwenken auf Harmoniebegleitung, um nicht grossartig aufzufallen. Also, man sollte die Midifile zuvor genauer studieren und trainieren um derartiger Überraschung Herr zu werden.
In größeren Räumen (Saal) oder Freibühnen stelle ich dazu eine Bluetooth Box, derzeit Typ Ibiza Port12VHF-BT, mit 350 W, mit in der Box integrieren Funksendern und dazu passend ein Funkmikrofon und ein Headset sowie ein Mikrofon- und ein Boxenständer auf. Diese Ausrüstung ist Dank in der Box verbautem Bluetooth und Akku kabellos und mit bis zu über 3 Stunden Spielzeit stromunabhängig einsatzbereit (mit Strom bzw. angeschlossenem Kabel natürlich zeitunbegrenzt) und benötigt nur sehr wenig Raum 1,5 m² (zwei Holzpaletten) so das selbst in kleinen Räumen in jeder freien Ecke, sogar auf einem Tisch, präsentiert werden könnte. Die Beschallungsleistung ist für 70 Personen locker ausreichend. Dennoch sollte für den Fall, dass wenn der Akku mal unerwartet früher leer ist als Plan B ein passendes Strom-Kabel für die Box und eine Kabeltrommel mitgeführt sein.
Ein Nachteil, wie halt bei allen strombetriebenen Verstärkern ist im Falle, wenn der Akku zuneige geht, und man dann über ein eingestecktes Stromkabel geht, zum einem das zusätzlich zu verlegende Kabel und zum anderem je nachdem wie der Stromkreis vor Ort bereits mit weiteren anderen Geräten wie z.B. alten Kühlschränken belastet ist, ggf. ein leichtes Brummen mit übertragen wird. Das kann bei längerer Auftrittszeit schonmal nervig werden. Hierzu kann bereits, wie im nachfolgendem Video "Brummschleifen vermeiden" erläutert, die Verwendung symetrischer Kabelverbindungen Abhilfe leisten.
https://www.delamar.de/audiokabel/brummschleifen-vermeiden-59135/
Hinweis: Beim Anklicken auf den oben eingestellten Link verlässt DU meine Seite und wirst auf eine andere Seite geleitet.
Um auf meine Seite zurück zu gelangen muß oben im Browser Augen Pfeil geklickt werden.
So funktioniert der "Sweet Midi Player"
im Gegensatz zum kostenlosen "vanbasco Karaoke Player" kann der „Sweet Midi Player“ auch die Begleitakkorde im Textfeld mit anzeigen!
MIDI: Was ist das und wofür wird es verwendet?
Die Geschichte und Funktionsweise von General MIDI können wir Ihnen mit den folgenden zehn Fakten beschreiben. In der anschließenden Bildergalerie erfahren Sie, wie Sie MIDI-Geräte anschließen können.
- MIDI steht für "Musical Instrument Digital Interface" und wurde in den 1980ern zum Austausch von Steuerungsdaten von digitalen Keyboards, Sequenzern, Synthesizern, Effektgeräten und Mischpulten eingeführt.
-
Auch andere Geräte wie Lichtanlagen oder Roboter können über MIDI-Daten gesteuert werden.
- General MIDI (GM) wurde in den frühen 1990ern eingeführt, um MIDI zu standardisieren.
- So lässt sich zum Beispiel auf 16 MIDI-Kanälen je eines von 128 standardisierten Instrumenten auswählen. Kanal 10 ist dabei als Schlagzeugspur vorgesehen.
- Die Datenpakete sind sehr klein, sodass ein ganzes Lied oft nur einige hundert Kilobyte groß ist. Vor allem bei alten PC-Spielen, die auf eine Diskette passen mussten, wurde häufig MIDI verwendet.
- Ein Druck auf eine Keyboard-Taste erzeugt zunächst einen Note-On-Befehl und eine Anschlagstärke zwischen 0 und 127. Beim Loslassen wird ein Note-Off-Befehl gesendet. Dazwischen können weitere Regler etwa die Lautstärke, Panorama, Tonhöhe oder Virbato-Frequenz manipulieren.
- Ein Sequenzer wie etwa Cubase kann diese Steuerungsdaten von einem Keyboard aufzeichnen und an einen physischen Klangerzeuger wie etwa Keyboards, Synthesizer und Drumcomputer oder einen virtuellen Klangerzeuger wie VST- oder Direct-X-Instrumente weiterleiten.
- Erst dieser Klangerzeuger generiert tatsächlich einen Klang, zum Beispiel aus einer Bibliothek (wie Sampler/Wavetables) oder durch Syntheseverfahren (wie Additive oder FM-Synthese).
- Es ist also nicht möglich MIDI in MP3 umzuwandeln oder umgekehrt. Allerdings können Synthesizer MIDI-Daten interpretieren und daraus einen Klang erzeugen, der sich wiederum als Audiodatei speichern lässt.
- Da es sich bei MIDI-Dateien um reine Steuerungsdaten und keinen Audio-Inhalt handelt, wurden MIDI-Files von urheberrechtlich geschützten Werken lange Zeit für legal gehalten und insbesondere für Karaoke-Anwendungen gehandelt. Da MIDI-Daten allerdings quasi einer Notenform des Stücks entsprechen und von vielen Programmen (wie MuseScore oder Finale) auch als Partituren ausgegeben werden können, greift auch bei MIDI-Dateien das Urheberrecht.
Quelle: https://praxistipps.chip.de/general-midi-was-ist-das_37661
Hinweis: Beim Anklicken auf den oben eingestellten Link verlässt DU meine Seite und wirst auf eine andere Seite geleitet.
Um auf meine Seite zurück zu gelangen muß oben im Browser Augen Pfeil geklickt werden.
MIDI für Anfänger einfach erklärt
Midi steht für “Musical Instrument Digital Interface” was übersetzt so viel heißt wie “Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente”. Eine Schnittstelle ist grundsätzlich dafür da, verschiedene Geräte miteinander zu verbinden um dann Daten übertragen zu können. Beim Computer gibt es zum Beispiel USB-Schnittstellen. Wenn man dort seine Digitalkamera anschließt, kann man die Bilder auf den Computer übertragen. Beide Geräte interagieren also miteinander. Nach dem selben Prinzip funktioniert auch die MIDI-Schnittstelle. Bei modernen Digitalpianos aller Preiskategorien gehört sie zum Standard. Was dahinter steckt und wie man sie optimal nutzen kann, verraten wir in diesem Artikel.
Wieso es MIDI gibt
Im Grunde genommen könnte jeder E-Piano Hersteller seine eigene Schnittstelle anbieten, wenn er dem Kunden das Verbinden unterschiedlicher Geräte miteinander ermöglichen möchte. In diesem Falle wäre man aber auf die Geräte und Erweiterungen eben dieses Herstellers angewiesen, was den Verbraucher doch sehr einschränken würde. So etwas möchte schlicht niemand. Wenn man einen Tintenstrahldrucker für den Computer kauft kann man sich darauf verlassen, diesen über die USB-Schnittstelle oder über WiFi mit jedem Gerät verbinden zu können. Egal von welchem Hersteller es ist. Um die Kompatibilität unterschiedlicher Geräte miteinander sicherzustellen, haben sich die großen Hersteller von Musikinstrumenten Mitte der 80er Jahre in der “International MIDI Association” auf eine gemeinsame Schnittstelle geeinigt. Dass dies ausgerechnet während der 80er zustande kam ist auf den Umstand zurückzuführen, dass zu dieser Zeit elektronische Tasteninstrumente und Computer einen Boom erlebt haben und der Wunsch entstand, diese miteinander zu verbinden um die Vorzüge aus beiden Welten miteinander zu vereinen und die Vorläufer moderner Musiksoftware und Sequenzerprogramme beim Produzieren von Musik zu nutzen. Die Midi-Schnittstelle war geboren. Universell, preiswert und simpel.
Midi-Anschluss & Signalübertragung
Der Anschluss in Form des charakteristischen Steckers selbst ist natürlich genormt. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Datenübertragung und -verarbeitung ebenso identisch vonstatten geht. Wie diese zu erfolgen hat, ist im sogenannten MIDI-Protokoll festgelegt. Dabei handelt es sich um eine Auflistung aller Spezifikationen, die ein Midi-Kabel und midi-fähige Geräte erfüllen müssen. Die Anschlussbuchsen selbst entsprechen dem Standard der bekannten Stereo-DIN-Buchsen mit 5 Polen. Sie unterscheiden sich jedoch, was die Schaltung anbelangt. Wichtig ist, das Midi-Kabel nicht während dem Betrieb sondern bei ausgeschaltetem E-Piano und PC ein- oder auszustecken. Es könnte sonst trotz elektronischer Entkopplung zu einem Kurzschluss kommen und Schäden entstehen. Bei der Midi-Schnittstelle handelt es sich um eine serielle Schnittstelle. Das bedeutet, dass die Datenübertragung in Serie, also die Signale hintereinander, über eine Leitung übertragen werden. Bei paralleler Datenübertragung könnten über mehrere Leitungen gleichzeitig Daten übermittelt werden. Das ist wie ein Schotterweg im Vergleich zu einer mehrspurigen Autobahn. Die Performance reicht fürs Digitalpiano aber mehr als dicke aus. Die Daten werden in binärem Code über Spannungszustände übertragen. Ein Midi-Datenwort besteht aus 10 Bit. Ein Start-Bit, ein Stop-Bit und dazwischen 8 Bit mit den Informationen des E-Pianos, die eigentlich für 1 Byte stehen. Der Einfachheit halber rechnet man Start- und End-Bit aber hinzu und spricht auch bei 10 Bit noch von einem Byte. Auch die Geschwindigkeit der Datenübertragung über MIDI ist genormt. So müssen in einer Sekunde 31250 Bits übertragen werden. Natürlich könnten über die USB-Schnittstelle deutlich höhrere Datenmengen umgesetzt werden – das Interface passt die Geschwindigkeit aber stets dem Midi-Standard an.
Die Midi-Buchsen beim E-Piano
Beim Digitalpiano findet man im Normalfall drei unterschiedliche Midi-Anschlüsse.
- MIDI-IN: Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen Eingang der zum Empfangen von Daten konzipiert ist.
- MIDI-OUT: Hier handelt es sich entsprechend um das Gegenstück zum Eingang und über diesen Port können Daten gesendet werden.
- MIDI-THRU: Die Bedeutung dieses Wortes erschließt sich, wenn man seine Funktion kennt. Diese Buchse leitet das Signal vom MIDI-IN einfach weiter und es lassen sich so mehrere E-Pianos hintereinander schalten. Die Daten werden also durchgeschleift (engl. “through”).
Wie MIDI funktioniert
Wenn man am E-Piano eine Taste drückt, wird MIDI übermittelt, um welche der 88 Tasten es sich handelt. Man spricht hier auch von einem “Note On”-Befehl. Außerdem enthält das Signal Informationen über die Anschlagsstärke, also die Geschwindigkeit, mit welcher eine Taste gedrückt worden ist. Man nennt diese Inormation auch “Note-On Velocity”. Die begabte Datenschnittstelle kann aber auch Änderungen in der Tonhöhe, die am Instrument vorgenommen werden, präzise übermitteln. Natürlich schließt dies die Pedalaktivitäten mit ein. Um die Signale empfangen zu können, wird ein sogenanntes “MIDI-Interface” benötigt. Es ist die notwendige Verbindung, die zwischen E-Piano und Computer geschaltet werden muss. Es gibt sowohl externe Audio-Interfaces als auch interne, die meist Bestandteil von Soundkarten sind. In der Regel stehen ausreichend MIDI Ins, Throughs und MIDI Outs zur Verfügung, um mehrere Instrumente gleichzeitig anschließen zu können. Mit einer MIDI-Patchbay, einem Verteiler, kann man die Anschlussmöglichkeiten sogar noch um einige Ein- und Ausgänge erweitern. Dabei handelt es sich in der Regel um ein externes Gerät, das ähnlich wie ein USB-Hub aussieht und zahlreiche Möglichkeiten zum Einstellen und Umschalten bietet. Bei modernen Computern und Soundkarten sucht man die Midi-Schnittstelle oft aber vergebens. Hier stehen nur noch USB-Anschlüsse zur Verfügung, über die die Midi-Datenübertragung stattfinden kann. Die Verbindung erfolgt mit einem USB-Midi-Interface. Dabei handelt es sich um ein USB-Kabel welches in den Computer eingesteckt wird und in der Regel zwei Midi-Stecker für Midi-In und Midi-Out, welche mit dem E-Piano verbunden werden. Dazwischen hängt für gewöhnlich ein kleines Kästchen, welches oft über LED-Leuchten eine stehende Verbindung anzeigt.
Was kann man mit der Schnittstelle anfangen?
Wenn diese Daten erst einmal an einen Computer übertragen worden sind bietet es sich natürlich an, sie mit einer geeigneten Software aufzuzeichnen und gegebenenfalls zu bearbeiten. Es gibt aber auch Lernsoftware wie “Synthesia” die über Midi mit dem Digitalpiano verbunden werden kann. Über das Tablet kann man dann Midi-Files welche man im Internet herunterladen kann in Synthesia importieren. Auf dem PC, Notebook oder Tablet kann man das Stück dann abspielen lassen. Man sieht eine Klaviatur und die Tasten die man drücken muss, werden farblich markiert. Die Software registriert natürlich, wann man die entsprechende Taste drückt und zeigt dann an, welche als nächstes betätigt werden müssen. So kann man ganz in seiner Geschwindigkeit und ohne Noten lesen zu müssen (auch wenn man diese trotzdem lernen sollte) üben und sich rasch neue Musik aneignen. Man kann Musik aber nicht nur über Software aufnehmen und als Midi-File abspeichern, sondern diese später auch wieder abrufen. Wenn sich jemand schon einmal gefragt haben sollte wie ein Selbstspielklavier funktionieren sollte – die Klaviermechanik wird elektronisch vom Computer gesteuert und die Saiten von dem wundersamen Selbstspielsystem angeschlagen. Da dieses wissen muss, welche Saite es in welcher Intensität anspielen muss, benötigt es entsprechende Informationen. Diese erhält es von einer Midi-Datei, die als Grundlage dient.
Praxistips zu Midifiles (zum öffnen unten auf Link klicken)
https://praxistipps.chip.de/midifiles-bearbeiten-so-gehts_95497
Hinweis: Beim Anklicken auf den oben eingestellten Link verlässt DU meine Seite und wirst auf eine andere Seite geleitet.
Um auf meine Seite zurück zu gelangen muß oben im Browser Augen Pfeil geklickt werden.
Keyboard Tyros 5 Aufnehmen, Midifiles erzeugen
Technische Angaben zu Bluetooth Box Ibiza

Bedienungsanleitung Ibiza-port12vhf-bt
https://www.bedienungsanleitung24.de/ibiza-port12vhf-bt
Hinweis: Beim Anklicken auf den oben eingestellten Link verlässt DU meine Seite und wirst auf eine andere Seite geleitet.
Um auf meine Seite zurück zu gelangen muß oben im Browser Augen Pfeil geklickt werden.
EIGENSCHAFTEN des PORT12VHF-BT / PORT15VHF-BT
- BLUETOOTH - Eingebauter Verstärker - Eingebauter USB MP3/WMA Spieler - REC & VOX Funktion - Eingebauter 2-Kanal VHF Mikrofonempfänger - Bass- und Treble-Regler - MIKROFON & ECHO Regler - MASTER Lautstärkeregler - MIKROFON & LINE Eingang - MP3 und iPod Eingang - Eingebaute, aufladbare Batterie - Handgriff und Rollen - Gewinde für einen Mikrofonhalter auf der Oberseite der Box - Versorgung : 220-240Vac 50/60Hz
Rückseite des PORT12VHF-BT / PORT15VHF-BT
1. USB Eingang, 2. SD Kartenslot, 3. MP3 Display, 4. MP3 Bedienelemente, 5. Eingangswahlschalter, 6. Master Lautstärkeregler, 7. Bass Regler,
8. Treble Regler, 9. Echo Regler, 10. Delay Regler, 11. VOX Ein/Aus Schalter, 12. Mikro1/Gitarreneingang, 13. Mikro 2 Eingang ,14. Linepegeleingang,
15. Ausgang zu Mischpult/Verstärker, 16. iPod/MP3 Eingangsbuchse, 17. Lautstärkeregler für VHF Mikros, 18. Lautstärkeregler festverb. Mikros,
19. Anschluss Antenne A, 20. Klangregler aller Mikrofone, 21. Signalanzeiger Kanal B, 22. Signalanzeiger Kanal A 23. Bluetooth Betriebs-LED 24. Bluetooth Ein/Aus/Lautstärkeregler, 25. Pairing Taste, 26. Bluetooth Pairing LED rot/blau, 27. Anschluss Antenne B, 28. DC Eingang, 29. Betriebs LED, 30. EIN/AUS Schalter, 31. Ladeanzeiger, 32. Sicherung, 33. Netzanschluss, 34. DC Sicherung
TECHNISCHE DATEN DES PORT12VHF-BT
Tragbare Beschallungsanlage 12"/30cm 350W
Höchstleistung.: .................................................................700W
SPL: ................................................................................97dB
Frequenzbereich: ......................................................40Hz – 20kHz
Verstärkerleistung: .................................................... 100W max.
Versorgung des Funkmikrofons ........................... 2 x 1,5V AA Batterien
TECHNISCHE DATEN DES PORT15VHF-BT
Tragbare Beschallungsanlage 15"/38cm 450W
Höchstleistung.: ................................................................. 800W
SPL: ................................................................................ 99dB
Frequenzbereich: ........................................................5Hz – 20kHz
Verstärkerleistung: ....................................................... 100W max
Versorgung des Funkmikrofons ........................... 2 x 1,5V AA Batterien
Alternativen mobile Beschallung
Gründe für brummende Lautsprecher
Ertönt aus Ihrem Lautsprecher ein Brummgeräusch, kann dies verschiedene Ursachen haben. So kann einerseits ein Gerätefehler vorliegen oder aber eine Einstreuung, die das Brummen verursacht. Der häufigste Grund ist allerdings die sogenannte Brummschleife. Diese wird entweder mechanisch oder durch den Ausgleichstrom zwischen den miteinander verbundenen Geräten bedingt.
- Ausgleichsströme fließen, wenn Ihr Verstärker und der angeschlossene Lautsprecher unterschiedliche elektrische Potentiale haben.
- Neben dem Musiksignal fließt so auch ein Ausgleichsstrom, durch den die Potentialdifferenz ausgeglichen werden soll.
- Allerdings entsteht dadurch ein Mischsignal, so dass neben der Musik auch ein Brummen aus den Lautsprechern zu hören ist.
Auch folgende Ursachen kommen für das störende Brummgeräusch bei Lautsprechern infrage:
- Trafos: Befinden sich Trafos in der Nähe, zum Beispiel von einer Lampe oder einem Aquarium, können diese für Brummeinstreuungen sorgen. Dies ist oft sogar der Fall, wenn sich die Trafos im Standby-Modus befinden.
- Verkabelung: Vom Cinch-Stecker bis zur Buchse - ein Defekt dieser Komponenten kann bei Lautsprechern für unangenehme Störgeräusche verantwortlich sein.
- Elektrogeräte: Da Elektrogeräte häufig starke Störfelder erzeugen, können diese ebenfalls zu Brummgeräuschen bei einem Lautsprecher führen. Stereoanlagen und dergleichen sollten sich daher nicht in direkter Nähe der Lautsprecher befinden.
Lautsprecher brummen: Problem beheben
Handelt es sich bei dem Brummen aus Ihren Lautsprechern um ein mechanisches Brummen, das durch die Konstruktion des Netzteils verursacht wird, lässt sich die Brummschleife nicht so einfach beheben. In diesem Fall bleibt nur die Möglichkeit, das Gerät auszutauschen. Wird das Brummen aber durch Ausgleichsströme verursacht, gibt es mehrere Lösungswege:
- Es kann helfen, wenn Sie die Geräte an dieselbe Steckdose anschließen oder die Cinch-Kabel austauschen.
- Haben Sie einen Antennenanschluss am Receiver oder Fernseher, kann dieser das Brummen verstärken. In diesem Fall kann ein Mantelstromfilter helfen.
- Falls möglich, können Sie ein optisches Medium zur Audioübertragung nutzen und die Brummschleife so unterbrechen.
Was ist akustische Rückkopplung und wie klingt sie?
Die akustische Rückkopplung (auch als Feedback bezeichnet) führt zu einem Effekt, der sich in einem unangenehmen, eindringlichen Pfeifen äußert.
Sie entsteht, wenn das von einem Mikrofon aufgenommene Signal verstärkt und so wiedergegeben wird, dass dieser Schall erneut vom Mikrofon aufgenommen, dann erneut wiedergegeben wird und so weiter. In der Praxis geschieht das auf der Bühne meist im Zusammenspiel von Mikrofon – Schallwandlung in ein elektrisches Signal Mischpult – Verstärkung des Signals Monitorlautsprecher – Rückverwandlung des Signals in Schallwellen. So entsteht ein geschlossener Kreislauf, in dem sich das Signal durch die akustische Rückkopplung immer weiter »hochschaukelt«. Das Resultat ist ein intensives, gerade bei der Live-Beschallung sehr unangenehmes Pfeifen, das in unterschiedlichen Tonhöhen auftreten kann. Die beteiligte Audiotechnik wird quasi zu einem Oszillator.
Quelle: www.delamar.de
Akustische Rückkopplung vermeiden – Was tun?
https://de.wikihow.com/R%C3%BCckkopplungen-vom-Mikrofon-vorbeugen
Damit Feedback keine Chance mehr hat, kannst Du die folgenden Dinge beherzigen. Kombiniere mehrere Maßnahmen, um die akustische Rückkopplung zu verhindern.
- Abstand zwischen Schallquelle und Mic so gering wie möglich halten
- Mikrofon mit Richtcharakteristik Niere bzw. Super-/Hyperniere nutzen
- Ein anderes Mikrofon mit Richtwirkung verwenden
- Bühnenmonitor passend zum Mikrofon ausrichten
- Grafischen EQ zum Abschwächen von Feedback-Frequenzen nutzen
- Feedback-Unterdrücker verwenden
- Gitarre & Bass direkt einspeisen
- In-Ear-Monitoring statt Bühnenlautsprecher nutzen
- Abstand zwischen PA-Lautsprecher und Mikrofon vergrößern
- Dicken Vorhang o.Ä. als Schalldämpfer an der Rückwand nutzen
Wie lässt sich der Bühnenmonitor in Relation zum Mikrofon ausrichten?
Richte den Bühnenmonitor genau so aus, dass er auf den umepfindlichsten Punkt in der Richtcharakteristik des Mikrofons im Stativ zielt. Oder besser: Winkle das Mikro entsprechend an – mit dem Gelenk der Klammer am Mikrofonstativ ist das einfach möglich. Bei einem Mikrofon mit Nierencharakteristik muss der Handgriff exakt senkrecht zur Oberfläche des Bühnenmonitors positioniert werden. Bei einem Mikrofon mit Super- oder Hyperniere ist aber genau in diesem Winkel noch eine gewisse Empfindlichkeit vorhanden. Daher musst Du das Mikro mehr oder minder waagerecht zum Bühnenboden auszurichten, sofern der Bühnenmonitor den Sound im klassischen 45-Grad-Winkel zu dir hin abstrahlt.
Was tun gegen bestimmte Feedback-Frequenzen?
Generell steigt beim Aufdrehen eines Equalizers die Feedback-Wahrscheinlichkeit, da die Lautstärke in einem bestimmten Frequenzbereich erhöht wird. Werden Mikrofone und/oder Lautsprecher mit deutlich akzentuierten Frequenzbereichen genutzt (besonders in den oberen Mitten und Höhen), steigt die Gefahr für akustische Rückkopplung ebenfalls. In diesem Fall könnte ein EQ wiederum hilfreich sein, schließlich dient er auch zum Abschwächen von überbetonten (Feedback-) Frequenzen. Allerdings ist dazu in aller Regel ein eigenständiger grafischer EQ nötig, da er die nötige Anzahl an justierbaren Frequenzbändern (typisch sind 31 Bänder) für gezielte Eingriffe bietet. Alternativ kannst Du …
Einen Feedback-Controller nutzen. Dieses Audiogerät soll akustische Rückkopplung automatisch verhindern. Es wird zwischen den Ausgang des Mischpults und die PA-Anlage geschaltet. Die Einrichtung erfolgt so: Beim Soundcheck wird die Mikrofonvorverstärkung voll aufgedreht, bis es zum Feedback kommt. In diesem Moment misst das Gerät die Feedback-Frequenz und erstellt einen entsprechenden Filter, um das Signal an genau dieser Frequenz abzuschwächen. Die Filter sind so schmalbandig, dass sie kaum einen Einfluss auf den Charakter der Musik haben.
Akustische Rückkopplung vermeiden
– das geht automatisch mit einem Feedback-Controller wie z.B. dem dbx AFS2.
Gerade im Amateursektor oder im semiprofessionellen Bereich werden Feedback-Controller gerne genutzt, um akustische Rückkopplung zu unterdrücken. Insbesondere bei wechselnden Vokalisten während einer Performance und/oder beim Bewegen des Mikrofons auf der Bühne können sie nützliche Dienste leisten. Sie werden auch »Feedback-Killer«, »Feedback-Eliminator« oder »Feedback-Destroyer« genannt.
Gitarre & Bass direkt einspeisen (via DI-Box oder Hi-Z-Input)
Jedes zusätzliche Mikrofon im Ring ist ein potentieller Herd für Feedback, also warum nicht auf ein oder zwei Mikros verzichten? Zumindest beim E-Bass sollte dass das geringste Problem darstellten – hier ist die DI-Abnahme des Signals eine musikalisch akzeptierte, etablierte Alternative zur Mikrofonierung einer Bassbox. Du bräuchtest also ein Mischpult mit mindestens einem hochohmigen Eingang (meist mit »Hi-Z« oder »Ins« beschriftet bzw. als Modus auf einem Line-Eingang zuschaltbar). Oder eine DI-Box.
Eine DI-Box (Direct Injection Box) ist ein Gerät, welches zwischen die Kabel eingesteckt, das unsymmetrische, hochohmige Signal deiner E-Gitarre bzw. deines E-Basses in ein symmetrisches, niederohmiges Signal umwandelt, das sich hervorragend zur Weiterverarbeitung und Verstärkung eignet.
In-Ear-Monitoring statt Lautsprecher nutzen
In-Ear-Kopfhörer sind eine echte Alternative zu Monitorlautsprechern (»Wedges«) geworden. Sie eliminieren eine der Hauptquellen für akustische Rückkopplung auf der Bühne und im Proberaum. Das setzt eine gewisse Aufgeschlossenheit voraus – der direkte, nahe Sound von Ohrhörern (in Verbindung mit einer gewissen Abschottung vom Raum) kann sehr gewöhnungsbedürftig sein. Trotzdem: Ausprobieren lohnt sich immer. Alles dazu findest Du hier: Haben Lautsprecher auf der Bühne ausgedient? » In-Ear-Monitoring statt Wedges Vergrößere den Abstand zwischen PA-Lautsprechern und Mikrofon Die PA-Lautsprecher zur Beschallung des Publikums sollten so weit wie möglich vor dem Mikrofon stehen. Anders gesagt: So nah wie möglich am Publikum. Außerdem sollten sie so gedreht werden, dass ein möglichster großer Teil des Abstrahlwinkels der Boxen genau auf die Zuhörer zielt. Das reduziert die Schallreflexionen von Wänden und Decke, die zum Mikrofon zurückgeworfen werden. Nutze einen dicken Vorhang o.Ä. als provisorischen Schalldämpfer im Rücken. Eine mehr oder minder glatte, massive Wand gleich hinter der Band reflektiert den Schall besonders stark in den Raum zurück. Und damit auch in die Einsprechrichtung des Mikrofons. Etwas Abhilfe schafft ein möglichst großer, schwerer und dicker Vorhang.
Details zu den Methoden gegen akustische Rückkopplung
Halte den Abstand zwischen Schallquelle und Mikrofon so gering wie möglich.
Gerade wenn die Stimme nicht sehr kräftig ist: Sprich, sing oder spiel so nah wie möglich an der Mikrofonkapsel. Dann muss der FOH-Techniker das Signal am Mischpult nicht so kräftig vorverstärken, was die die Feedback-Wahrscheinlichkeit reduziert.
Nutze ein Mikrofon mit Nierencharakteristik.
Die Empfindlichkeit von Mikrofonen mit einer Richtwirkung (kurz: Richtmikrofone) variiert je nach Winkel des auftreffenden Schalls. Das kannst Du dir im Zusammenspiel mit der Raumakustik und der Ausrichtung der Monitorboxen (siehe unten) zunutze machen. Verwendest Du hingegen ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik, ist die Feedback-Gefahr am größten. Hier wird der Schall aus allen Richtungen um die Mikrofonkapsel herum gleichstark aufgenommen, es gibt also keinerlei Gestaltungsspielraum.
Nierencharakteristik-
So könnte man von einem Mikrofon mit der Richtcharakteristik »Niere« stark vereinfacht sagen,
dass es »nur von vorne aufnimmt«. Klänge, die seitlich und vor allem von hinten auftreffen, sind deutlich leiser. Mikrofone mit einer Super- oder Hypernierencharakteristik blenden Geräusche von den Seiten noch stärker aus – Feedback-Gefahr durch Klängen links und rechts vom Mikrofon werden vermindert. Allerdings weisen sie anders als normale Nieren hinten eine gewisse Empfindlichkeit auf (»rear lobe«), was Du bei der Konstellation mit dem Bühnenmonitor (siehe unten) berücksichtigen musst.
Warum ein anderes Mikrofon verwenden?
Zwei Mikrofone gleichen Typs – z.B. aus der Sparte Dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik –, können unterschiedlich anfällig für Feedback sein. Im Schnitt sind höherwertige Mikrofone (ab ~100 Euro) besser gerüstet. Auch empfiehlt es sich, auf etablierte Marken wie Shure, AKG und beyerdynamic zu setzen.
Quelle: www.delamar.de
DY Box für was?
Die DI-Box (Abkürzung für Direct Injection, wörtlich übersetzt also in etwa „Schachtel zur direkten Einspeisung“) ist ein in der Tontechnik verwendetes Gerät, das ein asymmetrisches Signal in ein symmetrisches Signal umwandelt.
https://de.wikipedia.org/wiki/DI-Box#Funktionsweise_und_Verwendung
Akkordeon aufrüsten/ pimpen
zum Geburtstag viel Glück (Grußvideo mit Videoeffekte von CAPCUT)
Musikvideo erstellen mit KI
Vor- und Zurück nach Themenseite
herzlich_willkommen_navigation.html
wieviel_kostet_ein_alleinunterhalter.html
videoschau_mit_manni_on_tour.html
videoschau_mit_manni_zuhause.html
videoschau_mit_schalllaballa.html
lustig_gefunden_im_internet.html
praesentation_selbstgebaute_musikinstrumente.html
neu_diy_projekt_bastelgruppe_neu.html
diy_instrumente_selber_bauen_seite1.html
diy_schlagzeug_saiten-instrumente_selber_bauen.html
noten_lesen_und_verstehen_rhytmusarten.html
quintenzirkel_akkorde_klavier.html
lernvideos_ukulele_contrabass.html
homestudio_tonstudio_was_brauchste_alles.html